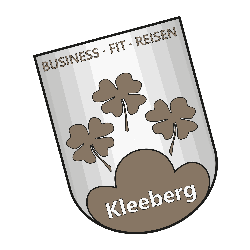Rückvergütung – eine scheinbar einfache Lösung mit riskanten Nebenwirkungen
In vielen Reisebüros hat sich in den letzten Jahren die Praxis etabliert, einen Teil der Provision an Kunden zurückzuzahlen – in Form von Gutscheinen, Überweisungen oder Preisnachlässen.
Was kurzfristig als „Kundenbindungsmaßnahme“ erscheint, ist betriebswirtschaftlich betrachtet eine strategische Sackgasse.
Denn: Die Rückvergütung vernichtet systematisch Marge – und das in einem Markt, der ohnehin durch Standardisierung, hohe Fixkosten und einen wachsenden Direktvertrieb der Veranstalter belastet ist.
Hinzu kommt: Die auszahlbare Provision sinkt seit Jahren – nicht nur prozentual, sondern strukturell.
Es gibt keine Provisionen auf Flugverkehrssteuer, Abschläge bei lokalen Abgaben (z. B. Mietwagensteuern), und bei Nur-Flug über Consolidator-Systeme erhalten Reisebüros keine klassische Vermittlungsvergütung mehr, sondern ausschließlich eine offen ausgewiesene Service-Fee.
Die sogenannte „Grundprovision“ ist längst kein verlässlicher Deckungsbeitrag mehr – sondern ein brüchiger Restwert, auf den auch noch Rückvergütung gewährt werden soll?
Das ist betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen.
Die betriebswirtschaftliche Perspektive: Kein Aufschlag, kein Spielraum
Im klassischen Einzelhandel kann der Unternehmer seine Preise so kalkulieren, dass alle betrieblichen Aufwände – von Miete über Personal bis Marketing – abgedeckt sind. Rabatte werden einkalkuliert. Rückvergütungen sind Teil der Preisgestaltung.
Im Reisevertrieb ist das nicht möglich.
Die Vermittlung von Veranstalterreisen unterliegt der handelsrechtlich vereinbarten Preisbindung.
Der Vermittler hat keine Preishoheit, sondern arbeitet mit einem vom Veranstalter festgelegten Endpreis.
Die einzige Einnahmequelle ist die Vermittlungsprovision – also die Entlohnung für Beratung, Vertrieb und Abwicklung.
Wer von dieser Provision auch noch Rückvergütung gewährt, reduziert seine eigene Entlohnung – bei gleichbleibender Kostenstruktur.
Beispiel: 10 % Rückvergütung auf eine 120 €-Provision sind 12 € weniger Deckungsbeitrag – ohne steuerliche Absetzbarkeit, ohne Vorfinanzierung durch Dritte, ohne Gegenwert.
Die strategische Wirkung: Rabatt zieht die Falschen an
Noch gravierender ist der strategische Effekt:
Rückvergütung zieht genau die Kundschaft an, die immer dort bucht, wo es gerade scheinbar „billiger“ ist.
Diese Zielgruppe:
- ist preissensibel, aber nicht loyal,
- verursacht hohen Beratungsaufwand, aber geringen Ertrag,
- vergleicht Anbieter nur über den Rückzahlungsbetrag – nicht über Kompetenz, Service oder Erreichbarkeit.
Wer auf Rückvergütung setzt, investiert in Streuverlust statt Kundenbindung.
Zugleich entsteht ein systemischer Preisverfall im Vertrieb:
Je mehr Reisebüros Rückvergütungen anbieten, desto mehr verliert die Beratung an Wert – und desto mehr gerät der gesamte stationäre Vertrieb unter Druck.
Unsere Erfahrung: Rückgrat statt Rückvergütung
Als betriebswirtschaftliches Beratungsunternehmen mit über 12 Jahren Erfahrung – und eigenem Reisebüro seit 2007 – kennen wir die Zahlen vieler Vertriebsformen. Und wir sehen deutlich:
Die nachhaltig erfolgreichen Unternehmer im Reisevertrieb haben Rückvergütung nicht nötig.
Sie bauen ihre Position auf:
- klarer Kommunikation,
- professioneller Beratung,
- und gelebter Verlässlichkeit.
Natürlich bedanken sie sich bei treuen Kunden – aber individuell, persönlich, unternehmerisch. Nicht automatisiert. Nicht rabattbasiert.
Ob kleines Geschenk, ein echtes Extra oder ein aufmerksamer Service: Diese Art von Wertschätzung ist situativ, nicht systemisch.
Sie stärkt Bindung – ohne Preisverfall.
Wer seinen besten Kunden etwas Gutes tun will, braucht keine Punkte, keine Rückvergütung und keine Prozent – sondern Menschenkenntnis, Fingerspitzengefühl und betriebswirtschaftliche Verantwortung.
Die bessere Strategie: Haltung zeigen – nach innen und außen
Wer als Unternehmer bewusst auf Rückvergütung verzichtet, entscheidet sich für:
- eine klare Preispolitik,
- eine ertragssichere Beratungsleistung,
- und eine Zielgruppe, die Beratung schätzt statt nur Preise vergleicht.
Diese Entscheidung braucht Mut. Aber sie ist betriebswirtschaftlich tragfähig, strategisch weitsichtig und persönlich konsequent.
Fazit: Rückvergütung ist kein Vertriebskonzept – sondern ein stiller Rückzug
Die Frage lautet nicht:
„Wie viele Kunden verliere ich, wenn ich keine Rückvergütung anbiete?“
Sondern:
„Was verliere ich, wenn ich meine Beratungsleistung dauerhaft unter Wert abgebe?“
Rückvergütung ist ein betriebswirtschaftliches Risiko –
und eine strategische Fehlentscheidung, wenn Beratung der Kern Ihres Geschäftsmodells ist.